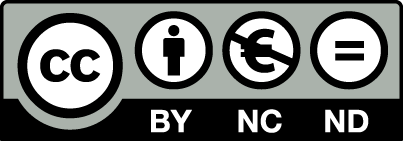Grillparzer, Franz
- Lebensdaten
- 1791 – 1872
- Geburtsort
- Wien
- Sterbeort
- Wien
- Beruf/Funktion
- Dramatiker ; Dichter ; Schriftsteller ; Lyriker ; Finanzbeamter ; Archivdirektor ; Hofrat ; Librettist
- Konfession
- katholisch
- Normdaten
- GND: 118542192 | OGND | VIAF: 12345937
- Namensvarianten
-
- Grillparzer, Franz Seraphicus
- Grillparzer, Franz
- Grillparzer, Franz Seraphicus
- Grillparzer
- Grillparzer, F.
- Grillparzer, Franciszek
- Grillparzer, Franz Seraphim
- Grilparc'eri, P'ranc'
- Grilparcer, Franc
- Grilʹparcer, Franc
- Grilʹpart︠s︡er, Frant︠s︡
- Grīlpāertzir, Frānts
- גרילפרצר, פרנץ
- 그릴파르쩌, 프란츠
- グリルパルツェル, フランツ
Vernetzte Angebote
- * Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 [2003-]
- * Filmportal [2010-]
- * Österreichisches Musiklexikon online [2002-2006]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1966] Autor/in: Baumann, Gerhart (1966)
- Catholic Encyclopedia. - New York 1917 (eingestellt) [1913-1922]
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Schönbach, Anton (1879)
- * Kalliope-Verbund
- Verzeichnis der künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen Nachlässe in Österreich
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Personendaten-Repositorium der BBAW [2007-2014]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- EGO European History Online
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte)
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- * Briefe an Goethe - biografische Informationen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- Personen in der Judaica-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt/Main
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
- Personen im Auftrittsarchiv der Wiener Philharmoniker
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
- Grillparzer, Wenzel
- Rizy, Johann Sigmund
- Rizy, Theobald Freiherr von/seit 1866
- Sonnleithner von Edelheim, Christoph Heinrich/seit 1834
- Sonnleithner, Christoph
- Sonnleithner, Franz Xaver
- Sonnleithner, Hippolyt Freiherr von/seit 1869
- Sonnleithner, Ignaz Edler von
- Sonnleithner, Johanna
- Sonnleithner, Joseph
- Sonnleithner, Leopold Edler von
Personen im NDB Artikel
- NDB 1 (1953), S. 364 (Arneth, Alfred)
- NDB 1 (1953), S. 648 (Bauernfeld, Eduard von)
- NDB 11 (1977), S. 141 (Karajan, Theodor Georg Ritter von)
- NDB 11 (1977), S. 697 (Klaar, Alfred)
- NDB 14 (1985), S. 196 (Lenau,, Nikolaus)
- NDB 14 (1985), S. 416 (Lewinsky, Josef)
- NDB 15 (1987), S. 266 (Lublinski, Samuel)
- NDB 15 (1987), S. 541* (Luther, Arthur)
- NDB 20 (2001), S. 411 in Familienartikel Pichler (Pichler, Caroline, geboren von Greiner)
- NDB 20 (2001), S. 600 (Politzer, Heinz)
- NDB 23 (2007), S. 610 in Artikel Schubert, Franz (Schubert, Franz Seraph Peter)
- NDB 24 (2010), S. 85 in Artikel Schwind, Moritz von
- NDB 24 (2010), S. 581* (Sonnleithner, Ignaz Edler von)
- NDB 25 (2013), S. 548 in Artikel Strich, Fritz
- NDB 27 (2020), S. 840 (Werner, Friedrich Ludwig Zacharias)
- NDB 27 (2020), S. 863 ( Wertheimer, Leopold Ritter von Wertheimstein)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Grillparzer, Franz Seraphicus
Dramatiker, * 15.1.1791 Wien, † 21.1.1872 Wien. (katholisch)
-
Genealogie
V →Wenzel (1760–1809), Dr. iur., Hof- u. Gerichtsadvokat, S d. Joseph, Traiteur auf d. Stadtger. in W., aus Bauernfam. in Bergheim/Oberösterreich (urspr. Grülnpartzer), u. d. Catharina Blum;
M Anna Franziska (1767–1819), T d. →Christoph Sonnleithner (1734–86), Dr. iur., Hofger.advokat u. Dekan d. Juristenfak., Hofrichter d. Schottenstifts¶, Komponist (s. ADB 34; Wurzbach 36), u. d.|Maria Anna Doppler;
Om →Franz Xaver Sonnleithner (1759–1832), k. k. Rat u. Magistratssekr. in W., staatswiss. Schriftsteller (s. Wurzbach 36), →Joseph S. (1766–1835), k. k. Hoftheatersekr., Schriftsteller, Komponist, Gründer d. Wiener Musikver. (s. ADB 34; Wurzbach 36), →Ignaz Edler v. S. (1770–1831), Prof. d. Handels- u. Wechselrechts am polytechn. Inst. in W., Gründer d. Allg. Versorgungsanstalt 1823 (s. ADB 34), →Christoph Heinr. S. v. Edelheim (1773–1841), Kreishptm. (s. Wurzbach 36); Tanten - m Franziska S. (⚭ →Joh. Sigmund Rizy, 1759–1830, Dr. iur., Hof- u. Gerichtsadvokat), →Johanna S. (1777–1871, ⚭ Franz Theser), Pianistin;
Vt →Theobald Frhr. v. Rizy (1807–82), Dr. iur., k. k. WGR, 1. Senatspräs. d. Obersten Ger.- u. Kassationshofs, →Leopold Edler v. Sonnleithner (1797–1873), Dr. iur., Hofger.-Advokat, Freund Schuberts u. G.s (s. Wurzbach 36), →Hippolyt Frhr. v. Sonnleithner (1814–97), k. k. WGR, Botschafter; - ledig. -
Biographie
G. kam als ältester von vier Söhnen in Wien am Bauernmarkt 10 zur Welt. Er hat zeitlebens, neunzehnmal die Wohnung wechselnd, in dieser Stadt gelebt. Der in seinen juristischen Geschäften nicht sehr geschickte Vater starb bereits 1809, so daß G. schon früh für Mutter und Brüder eine Art Vaterstelle vertreten und nach Verdienst suchen mußte.
Seine Brüder, vor allem Karl, führten ein unglückseliges Leben, in das der Dichter immer wieder helfend eingreifen mußte. Adolf, der Jüngste, ging 1817 siebzehnjährig in die Donau, die Mutter verübte 1819 Selbstmord. Der Knabe erhielt zunächst Privatunterricht und besuchte ab 1801 das Anna-Gymnasium. Schon früh war er, der aus dem Spielbuch der „Zauberflöte“ das Lesen lernte, ein unersättlicher Büchernarr. 1804 nahm er das Studium an der philosophischen, 1807 an der juristischen Fakultät in Wien auf. Lebhaften Anteil widmete er der jugendlichen „Gesellschaft zur gegenseitigen Bildung“ (1808) unter der Leitung seines Freundes Altmüller. Am Beginn seiner literarischen Tätigkeit, die in diese Zeit fällt und eine erstaunliche Anzahl von bleibenden Dramenentwürfen und Plänen zutageförderte, stehen bezeichnenderweise auch Übersetzungsarbeiten, unter anderem die Nachbildung von Calderons „Das Leben, ein Traum“. Es ist die Zeit einer fast widerwilligen Faszination durch den Dramatiker Schiller, dessen Einfluß bald durch →Zacharias Werner und Goethe abgelöst wurde, und der Begegnung mit Shakespeare, dem sich G., zwischen grenzenloser Verehrung und ängstlicher Abwehr schwankend, niemals entziehen konnte. Die lebendige Wiener Bühne lockte zu Musikdrama, Singspiel und Oper. Doch die 1808-10 entstandene „Blanka von Kastilien“ wurde dem Burgtheater, das G.s Onkel Josef Sonnleithner 1804-14 leitete, vergeblich eingereicht. Seit 1810 erteilte G. Privatunterricht, 1812 hatte er, mit Unterbrechung durch eine heftige Erkrankung an Nervenfieber, eine Hauslehrerstelle bei den Grafen von Seilern inne. 1813 wurde er Praktikant an der Hofbibliothek, ab 1814 füllte er wechselnde Stellungen bei der Finanzkammer aus.
In das Jahr 1816 fällt die entscheidende Begegnung mit Josef Schreyvogel, dem neuen Leiter des Burgtheaters. Unter seinen Augen wurde „Die Ahnfrau“ sehr rasch niedergeschrieben und mit großem Erfolg aufgeführt. Daraufhin wurde G. 1818 zum Hoftheaterdichter bestellt.
Im Frühjahr 1819 begann G. eine enttäuschende Reise nach Italien über Venedig, Florenz nach Rom und Neapel. Durch die verspätete Rückkehr, Anfang August 1819, geriet er in eine Reihe von Schwierigkeiten mit seinen Amtsbehörden, die durch den Tod seines Gönners, des Finanzministers Graf Stadion, noch mißlicher wurden. Hinzu kamen die ständigen Reibungen mit dem kaiserlichen Hof und der Zensur, die zum ersten Male 1819 durch sein Romgedicht „Campo Vaccino“ ausgelöst wurden. Aus einer besonders unleidlichen Situation im Jahre 1826 befreite ihn eine Reise durch Deutschland über Prag, Dresden, Berlin, Weimar und München, auf der es zu Begegnungen mit Tieck, Hegel, Peter Cornelius und Goethe kam, bei dem er sich vom 29.9. bis 3.10.1826 aufhielt (s. Selbstbiographie und Goethes Brief an Zelter vom 11.10.1826: „Grillparzer ist ein angenehmer wohlgefälliger Mann; ein angeborenes poetisches Talent darf man ihm wohl zuschreiben; wohin es langt und wie es ausreicht, will ich nicht sagen. Daß er in unserm freien Leben etwas gedrückt erschien, ist natürlich.“). In Wien selbst traf G. außer mit seinem besten Freund Schreyvogel auch mit Werner, Raimund, Bauernfeld, später Feuchtersleben und mit Beethoven zusammen, für den er 1823 das (nachmals von Conradin Creutzer vertonte) Singspiel „Melusina“ vollendet hatte. Das Freundschaftsverhältnis zu Stifter, der G. die tiefste Verehrung entgegenbrachte, überdauerte die gemeinsamen vierziger Jahre in Wien. Sein schönstes Zeugnis ist Stifters knappe Besprechung des „Armen Spielmann“ (1847). Der Bekanntschaft mit Hebbel jedoch (1845) war keine Entwicklung beschieden.
Großen Anteil an den schmerzlichen Spannungen der zwanziger Jahre hatten G.s sich teilweise verschränkende Begegnungen mit vier Frauen, Charlotte von Paumgartten, Marie von Piquot, →Katharina Fröhlich und Marie von Smolenitz, die alle in einer peinlichen|Schwebe zwischen Bindung und Lösung blieben. Nur das ungelöste Verhältnis zu „Katty“ ging allmählich in eine lebenslange Freundschaft über. In dieser Zeit entstanden die kleine Gedichtsammlung „Tristia ex Ponto“ und nach der „Ahnfrau“ die Dramen „Sappho“ (1817), „Das goldene Vlies“ (1818/19), „König Ottokars Glück und Ende“ (1823), „Ein treuer Diener seines Herrn“ (1826), „Des Meeres und der Liebe Wellen“ (1829) und „Der Traum ein Leben“ (1831 beendet), der letzte Theatererfolg des Dichters.
Nach einer Reise nach Ischl (1831) wurde G. 1832 zum Direktor des Hofkammerarchivs ernannt; erst 1856 zog er sich von diesem Amt, das ihm genügend Zeit für seine literarische Tätigkeit ließ, als Hofrat in Pension zurück. Die Ernennung zum Archivdirektor leitete eine neue Epoche seines Lebens ein. Intensive wissenschaftliche Beschäftigung vor allem mit der Philosophie Hegels, zu der sich rasch eine Gegnerschaft herausbildet, mit deutscher, besonders älterer Sprache und Literatur und mit romanischer und klassischer Literatur nimmt von nun an einen immer breiteren Raum ein. Die spanischen Studien über Cervantes, Calderon und vornehmlich Lope de Vega weiten sich aus. Verstärkt wurde diese Wendung durch den Mißerfolg seines Lustspiels „Weh dem, der lügt“ auf dem Burgtheater (März 1838), nach dem der verstimmte Dichter kein weiteres Drama mehr zur Veröffentlichung und Aufführung preisgab.
Einer letzten Liebesbegegnung mit Heloise Hoechner folgte 1836 eine fast fluchtartige Reise nach Paris und London. Diese Reise nach Westeuropa wurde im August 1843 durch eine zweimonatige Balkanfahrt ergänzt, die über Preßburg, Budapest, Belgrad nach Konstantinopel und Athen führte. Die österreichische Revolution im Frühjahr 1848 brachte einen deutlichen Umschwung in G.s politischem Denken; nach einer bisher vorwiegend liberalen Haltung wurde er nun zum Sprecher der Ordnungsmächte Armee, Staat und Kaiser. Neben gelegentlicher Arbeit an vielen für immer unvollendet gebliebenen dramatischen Plänen – das Esther-Fragment blieb 1848 endgültig liegen – wurde in diesem Jahr die Novelle „Der arme Spielmann“ abgeschlossen, in die einige Elemente des lange gehegten autobiographisch-satirischen Romanplans „Fixlmüllner“ eingingen.
In den nun folgenden ruhigeren Jahren – G. hatte sich 1849 endgültig in der Spiegelgasse bei den Schwestern Fröhlich niedergelassen – stellten sich zahlreiche Ehrungen ein. Mit →Heinrich Laube, dem neuen Leiter des Burgtheaters und Hebbel-Gegner, brach eine neue Grillparzer-Ära auf der Bühne an. Trotz allem widersetzte sich G. starrsinnig dem Plan, seine „Gesammelten Werke“ herauszugeben. Die Edition wurde erst 1872 von Laube besorgt. Drei große Tragödien, die den Dichter fast lebenslang begleitet hatten und die er nach seinem Tode vernichtet wissen wollte, wurden in diesen letzten Jahren vollendet: „Libussa“ (1848), „Die Jüdin von Toledo“ (in den fünfziger Jahren) und „Ein Bruderzwist in Habsburg“ (1873), den er noch in den sechziger Jahren überarbeitete. 1861 wurde G. zum Mitglied des Herrenhauses ernannt, aber ein Sturz von der Treppe (1863), der ihn fast taub machte, ließ ihn sich immer stärker von der Öffentlichkeit zurückziehen. Eine Frau, Auguste von Littrow, brachte ihm im letzten Jahrzehnt Geselligkeit und Welt in sein Zimmer. Er starb 1872, ein Jahr nach seinem feierlich und ehrenvoll begangenen 80. Geburtstag.
G.s geistige Herkunft reicht weiter zurück und ist vielschichtiger angelegt als diejenige der deutschen Dramatiker. Erstand die Bühne Weimars als bewußte Schöpfung miteinander verbundener Dichter, so bildet Wien eine ursprüngliche Stadt des Schau-Spiels aus Jahrhunderten, vereinigen sich hier zahlreiche Einflüsse, eine verschwenderische Berührung der Sphären. Dichtung bedeutet G. nicht unmittelbarer Niederschlag von Erfahrungen und Auseinandersetzungen, vielmehr ein Spannungsfeld aus Einbildungskraft und Kalkül, Bewußtsein und Gefühl, das unablässig widersprüchliche Gesichte vermittelt. Immerwährender Wechsel auf überkommenen Grundlagen bezeichnet für G. das Gesetz der Dauer; vorsätzlicher Wahrer der Tradition, wurde er zum widerwilligen Wegbereiter einer weitreichenden Entwicklung.
Aufschließend für seine Wesenserkenntnis sind die Tagebücher; in ihnen offenbart sich ein kaum faßbarer Grad der Bewegungslosigkeit. In quälender Selbstanalyse durchdringen sich die Lebensepochen ebenso formwie alterslos: ein Spiel vor sich selbst, das er nie ganz ernst nimmt, aber auch niemals scherzhaft aufzulösen vermag. Dabei bergen diese Zeugnisse politische und künstlerische Einsichten von erstaunlichem Weitblick, kristallisieren Aphorismen von bemerkenswerter Schlagkraft.
Das Widersprüchlichste durchdringt sich in G. und bewirkt die unauflösbaren Spannungen: josephinische Aufklärung vereinigt sich mit der Neigung zur Opposition, prophetische Hellsicht mit Hypochondrie. G. rechtfertigt in seinen Dichtungen das Konservative in abgeklärter Weisheit und kritisiert es unerbittlich in allen Äußerungen zum Tage; er erkennt das Ehrwürdige wie das Fragwürdige der überreichen Überlieferung. Die barocke Ausdruckswelt fasziniert ihn, aber ihr Größenmaß bewundert er mit Schaudern. Unablässig fühlt er sich zum Bekenntnishaften gedrängt, und zugleich hegt er ein unüberwindliches Mißtrauen gegenüber der Öffentlichkeit, leitet ihn das Bestreben, auszuweichen, sich zu verbergen. Unverkennbar ist ein slawischer Zug, jene Wollust der Selbsterniedrigung, wie man sie an Figuren Dostojewskijs beobachten kann. Resignation und der Sinn für das Abgründige dieses Sich-Kleindünkens, das sich bis zum Erhabenen steigert, bestimmt seine persönlichsten Dichtungen.
G.s Abwehr gegenüber beherrschenden Erscheinungen muß als Akt der Selbstverteidigung verstanden werden. Hinter seinem Quietismus verbirgt sich aktive Passivität. Zurückhaltend gegenüber Shakespeare und Goethe, die Romantik verleugnend, gilt seine ungeteilte Zuneigung den attischen Tragikern und den Dramatikern des spanischen siglo de oro. In seinen „Spanischen Studien“, die vornehmlich um Lope de Vega kreisen, offenbart G. am reinsten Kunstwollen und dichterische Gesinnung. Hier entdeckt er die ihm wahlverwandte Verbindung von Würde und Elend des Menschen, die Umsetzung des Ideellen in das Sinnfällige, das Zugleich von ausladender Sprachgebärde und abbrechendem Lakonismus, prunkendem Schein und ergreifender Desillusion, das rätselhaft Vieldeutige. Zum Verständnis von G.s Geisteshaltung ist es notwendig, zu berücksichtigen, daß in Österreich der Geist des 18. Jahrhunderts später durchdringt und länger sich erhält. Auf dem Gebiet der Religion spürt G. den Unterschied auf zwischen Glauben und Meinen: „Die Irreligiösen sind religioser als sie selbst wissen, und die Religiosen sinds weniger als sie meinen.“ Unter Gläubigen gibt er sich ungläubiger als er ist, gegenüber Ungläubigen bewahrt er sich gläubig. Er bezweifelt alles, was unanfechtbaren Anspruch erhebt, und bewundert dennoch das Christentum. Religiösen Überzeugungen gegenüber verhält er sich indifferent, das religiöse Bewußtsein bleibt ihm unantastbar. Seiner geistigen Herkunft blieb er jedoch unbeirrbar treu. Die Jugendeindrücke aus dem Vorstadttheater, die exemplarischen Feen-, Geister- und Märchenspiele, welche barocke Szenerie und den Geist der Aufklärung verbinden, lassen sich unschwer bis zur „Libussa“ verfolgen.
Hatte die Geschichte Schiller die stofflichen Vorwürfe geboten, so bedeutet sie G. ein Lebenselement. Bewunderte Schiller in ihr die jeweiligen Entscheidungen, so erblickt G. das Unabschließbare. So war er ihr zutiefst verbunden und wurde zugleich, vor Nietzsche, zu einem entschiedenen Verächter der Historie. Thesen und Werk, Vorsatz und Vollzug bilden einen unausgleichbaren Widerspruch, der sich von Beginn an verfolgen läßt. Das Frühwerk „Blanka von Kastilien“ nimmt sich einerseits wie eine „Don Carlos“-Parodie aus, andererseits erkennt man durchgängige G.sche Eigentümlichkeiten. Der Aufbau ist Schiller weitgehend nachgebildet, die Ausdrucksmittel ihm entlehnt und dennoch wesentlich verändert. Klar gegliedert, machtvoll geballt drängt die Sprache Schillers ungestüm vorwärts, dem Definitiven zu; bei G. behält sie etwas Zögerndes; sie enthüllt Unausgesprochenes und unterdrückt abbrechend das Entscheidende. Die Interferenz von Sprache und Bewußtsein, die G. eigentümlich, zeichnet sich bereits ab. Thematisch führen Bezüge zum „Treuen Diener“ und zur „Jüdin von Toledo“. Nicht das Wort schafft die Gebärde, vielmehr diese das Wort, das stumme Drama, die Pantomime, erscheint schon vorgebildet. Die „Ahnfrau“ verrät gleichfalls die schöpferische Auseinandersetzung mit Vorbildern: den Wiener Volks-, Gespenster- und Märchenstücken, Calderón, Schillers „Braut von Messina“, dem Frühwerk Byrons, Zacharias Werner und Adolf Müllner. Der atemlos dahinjagende Schicksalsentwurf erfährt eine bezeichnende Umbildung; indem den Figuren jegliche Willenskraft versagt bleibt, erschöpft sich ihr Schicksal in Angst und Ohnmacht, Projektionen eines Alptraums, sie selbst nur Medien des Gewissens, Ahnen der „Gespenster“ von H. Ibsen. Dieser Mangel an Selbstbesitz prägt entscheidend das Wesen seiner Dramen und ihrer Gestalten; „Sappho“ bezeugt das ebenso eindringlich wie die „Jüdin von Toledo“. In der „Sappho“ erscheint das Brüchige und Hilflose bis zum Peinlichen überzogen, was nicht zuletzt durch den Stil bedingt ist. An Wieland und den „Tasso“-Goethe wähnte G. sich anzulehnen, allein die Sprache ist völlig zum vag Gefühlshaften aufgeweicht, gerät spannungslos und flach, so daß weite Strecken Librettocharakter annehmen, ein Eindruck, der durch zahlreiche Opernzüge verstärkt wird. Das Konventionelle und Ausleihbare bestätigt sich als Nachwirkung in der Verssprache Gerhart Hauptmanns.
Mit „König Ottokars Glück und Ende“ erweitert sich G.s Drama zu den Dimensionen des „Großen Welttheaters“; für seine Anfänge bereits blieb es bedeutsam, daß er sich an einer Übertragung von „La vida es sueño“|des Calderon versucht hatte, dem er dann in schöpferischer Erwiderung und in bemerkenswerter Vereinigung mit Voltaire „Traum ein Leben“ gegenüberstellt, eine Thematik, die alle seine Vorwürfe durchwirkt. Freilich steht die Weltbühne des Österreichers nicht mehr vor dem geschlossenen Horizont des Barock aus göttlichem Gesetz und unangreifbarem Glauben, vielmehr im Spannungsfeld von gläubigem Zweifel und einer Verzweiflung, an die man nicht glaubt. Spanische und österreichische Überlieferungen begegnen sich im exemplarischen Drama, und dieser Lehrcharakter erhält sich über den „Treuen Diener“, über „Weh dem, der lügt“, dem Spiel um Mißtrauen und Mißverstehen, das nur zu schwer befrachtet ist, um die Tiefe an der Oberfläche zu verbergen, über den „Bruderzwist in Habsburg“, die „bedeutendste historisch-politische Tragödie der Deutschen“ (Hofmannsthal) hin zur „Jüdin von Toledo“ und zur „Libussa“, diesem unvergleichlichen Werk, weisheitsschweres Zaubermärchen und politische Vision in einem.
Zunehmend erstrebt G. ein Drama der Konfiguration; in ihm steht jede Figur nicht allein für sich, sondern zugleich für alle anderen, spielt gleichermaßen eine potentielle wie aktuelle Rolle; für jede kommt ein Augenblick, in dem sie innerhalb der Konstellation entscheidend das Geschick ihrer Mitfiguren bestimmt. G. entdeckt im Unauffälligen mit Vorliebe das Wesentliche; er weiß um die Bedeutsamkeit des „Fast-nicht“, und es gelingt ihm, das Zage und Spröde szenisch zu offenbaren. Das wechselseitige Sich-Erhellen macht ausholendes Reden entbehrlich und enträtselt das Komplexe in sinnfälliger Situation. Gefühltes setzt sich um in Gebärde, das Wort vereinigt sich mit Wortlosem, Zufälliges mit Notwendigem. Da G. – wie alle Österreicher – nicht auf dem Gegensatz von Natur und Idee beharrt, vielmehr beides zusammensieht, vermeidet er falsches Pathos und unechte Tiefe. Das Eruptive freilich wie das Fortreißende, das Miteinander von Hochflug und Gewaltsamkeit, wie es Schiller eigen, versagt sich solcher Gesinnung; denn sie verwirklicht nie das Revolutionäre, Abenteuerliche, Anmaßende, vielmehr das Maßvolle und Legitime. Das Individuum wird nicht als Träger der Idee in seiner Auseinandersetzung mit den Widerständen vorgestellt, vielmehr sind alle Spannungen, ja oft noch das Tun, in die Figur hineingenommen. Man erkennt die Opfer des Gewissens, heilloser Selbstentfremdung, nicht das Unbedingte, sondern das allseitig Bedingte. Vor allem weiß G. um die zahlreichen Selbstwidersprüche; verdeckte Geständnisse werden herausgezögert, wenn die Oberfläche des Bewußtseins durchgeschliffen, unbewußtes Fühlen faßbar erscheint; jede Aussage ist vom jeweiligen Bewußtseinszustand mitbestimmt, nicht ablösbar von der Situation. Dabei bevorzugt G. Grenzsituationen, in denen sich Forderungen des Bewußtseins und Regungen des Unbewußten berühren. Vornehmlich die Frauengestalten gewinnen dadurch etwas lebensvoll Unwägbares. Mißtrauisch gegenüber der Sprache, scheuen sie alles Grelle und Überschwengliche; sie erfahren, wie Worte trennen und Gebärden verbinden. Das Drama G.s lebt nicht aus dem Willen zum Ziel, kein Pathos peitscht es ins Fernzukünftige. Die Reihung eigenständiger Situationen läßt eine schillersche „Präzipitation“ ebensowenig aufkommen wie einen straffen Funktionalismus, der jeden Teil nur als Funktion des Ganzen gelten läßt. Schon in seinen zahlreichen Entwürfen spannt G. nicht wie Schiller den Bogen, von dem sich das Geschehen zielsicher abschnellt, um einem abschließenden Urteil zuzueilen, vielmehr umkreist er Situationen, in denen Kräfte gegeneinander ausbalanciert werden, es mehr um das Gleichgewicht als um Schuld geht, mehr um das In-sich-Gespannte als um Spannung zum Künftigen hin. Wie die Frucht aus der Schale entspringt die Handlung den Bedingungen der Situation, erwartet, wenn auch nicht ohne Überraschungsmomente. Weniger ein Prozeß als spannungsvolle Zustände, nicht Willensentladungen, sondern Gesinnungen, weniger die Tat als deren Voraussetzungen und Nachwirkungen bestimmen Gestalten und Abläufe. Anstelle verkürzender Folgerichtigkeit und Schlagkraft tritt ein Wissen um das Fragwürdige jeglicher Entscheidung, um die widersprüchliche Vielfalt von Möglichkeiten, die sich hinter der Wirklichkeit verbergen, und Wirklichkeiten, die sich als Illusionen entlarven. Die Situationen bilden dramatische Zentren; darin eifert G. den spanischen Dramatikern nach, vor allem dem verehrten Lope de Vega. Die ausgedehnten Studien, die er ihm widmet, deuten die eigenen Strukturen und Vorstellungen, während die programmatischen Äußerungen über seine Dichtung mit dieser selbst unvereinbar bleiben.
Das Miteinander ist G. so wesentlich wie das Nacheinander, und in den späten Schöpfungen erreicht er damit seine eigentümlichsten Wirkungen. „Bruderzwist“, „Libussa“, „Jüdin“, „Esther“ bieten die vollkommenste Verwirklichung in Struktur und Thema. Ähnlich dem reifen Shakespeare bevorzugt er die auf den Widerschein ausgerichteten Szenen, ein Szeniker der dreidimensionalen Phantasie die räumliche Gliederung gesellt sich ebenbürtig zur zeitlichen, ein Miteinander locker gefügter Begebenheiten. Die Handlung wird im Medium der beteiligten Figuren reflektiert; Gestalt und Geschehen erscheinen dabei derart ausgewogen, oft in schwebendem Gleichgewicht gehalten, daß nichts Vorrang beanspruchen kann, daß vieles offen und vielfache Sichtweisen möglich bleiben. Keine Gestalt und kein Raum erschöpft sich im bloßen Wozu, aber jede Figur wirft Licht und Schatten auf andere, jeglicher Raum entläßt weitere Räume aus sich, so daß sich tiefe Handlungsfluchten bilden. Ein seltener Reichtum an Durchblicken und Spiegelungen faltet sich aus, eine fast unübersehbare Fülle von Relationen. In diesen Brechungen und Spiegelungen gerinnt der Zeitfluß zu einer Folge von phasenhaft in sich abgeschlossenen Zeiträumen.
Bei einer derartigen Anlage kommt dem Beginn besondere Bedeutung zu; er übergreift den Rahmen einer bloßen Exposition. Der Eingang zur Erzählung vom „Armen Spielmann“, weitgehend dem „Römischen Karneval“ von Goethe nachgebildet, belegt beispielhaft das Vorgehen G.s. Das Zeitfeld zwischen „Noch“ und „Schon“ wird ausgemessen, nichts nur punktuell berührt, so daß jede Figur zugleich als Geschehen erscheinen kann. Bewegung und Gegenbewegung durchkreuzen sich, Hohes und Niederes, Ephemeres und Zeitloses, das Soziale und das Absonderliche, Traum und Bewußtsein. Die einzelnen Episoden laden sich gegenseitig dramatisch auf, ein Prinzip, das sich am „Ottokar“ ebenso nachweisen läßt wie am „Bruderzwist“.
Zeichnet sich im Anfang nicht selten bereits der Ausgang ab, so bietet dieser nicht weniger einen Abschluß als einen Beginn. Epigrammatische, entschiedene Schlüsse in der Art Shakespeares oder Schillers liegen ihm fern. Wem sich schon der unscheinbarste Vorgang als vielfach bedingt zeigt, der kann sich nicht zum Entschiedenen, Endgültigen bekennen, dem fehlt der Glaube an das unzweifelhafte Zu-Ende-Sein; ihm bleibt alles vieldeutig offen, wie später aus verwandtem Ursprung für Hofmannsthal. Die Spätwerke mit ihren verhangenen Schlüssen weisen eindringlich auf das Ausweglose, auf den Zwang, wieder anzufangen und zurückzukommen, eine ebenso weisheitsvolle wie unerbittliche Altersfernsicht. Im dramatischen Raum begegnen sich Herkunft und Zukunft, er empfängt die Reflexe menschlicher Auseinandersetzungen, wie die Menschen von ihm gehalten, ja gebunden werden. Offen zugleich und geschlossen, verdichtet sich in diesen Räumen das Geschehen und erreicht szenische Sichtbarkeit, Spielraum des Augenblicks und zeitlose Stätte, in welcher der Mensch sich erkennt und in der er gerichtet wird.
-
Werke
Hist.-krit. Gesamtausg. v. A. Sauer, 1909 ff., Abt. I Werke, II Tagebücher, Jugendwerke, III Briefe;
G.s Gespräche u. Charakteristiken s. Persönlichkeit durch d. Zeitgenossen, hrsg. v. dems., Bd. 1-7, 1904-41;
K. Vancsa, G.-Bibliogr., 1905–37, in: Jb. d. Grillparzer-Ges. 34, 1937;
ders., F. G., Bild u. Forschung, 1941. -
Literatur
ADB IX;
E. Kuh, F. G. - Adalbert Stifter, Zwei Dichter Österreichs, Pest 1872;
A. v. Littrow-Bischoff, Aus d. persönl. Verkehr mit F. G., 1873;
W. Scherer, Vorträge u. Aufsätze z. Gesch. d. geistigen Lebens in Dtld. u. Österreich, 1874;
J. Volkelt, G. als Dichter d. Tragischen, 1888;
A. Foglar, G.s Ansichten üb. Lit., Bühne u. Leben, ²1891;
H. v. Hofmannsthal, Notizen z. e. G.-Vortrag (1904), in: ders., Ges. Werke, hrsg. v. H. Steiner, Prosa II, 1951, S. 85-94;
ders., G.s pol. Vermächtnis, ebd., Prosa III, 1952;
Rede auf G. (1922), in: ders., Ges. Werke III, 3, 1934, S. 107-23;
ders., Österreich im Spiegel s. Dichtung, ebd., S. 46-60;
M. Mell, Versuch üb. d. Lebensgefühl in G.s Dramen, in: Jb. d. Grillparzer-Ges., 1908, S. 1-26, vgl. dazu Brief v. Hofmannsthal an Mell vom Sommer 1908, in: H. v. Hofmannsthal, Briefe II, 1937, S. 325;
F. Strich, G.s Ästhetik, 1905;
A. Tibal, Etudes sur G., in: Ann. de l'Est 28, 1, Paris-Nancy 1914;
R. Pannwitz, G.s hist.-pol. Dramen, in: Österr. Rdsch. 57, 1918;
G. Lukács, Zur Soziol. d. modernen Dramas, in: Archiv f. Soz.wiss. u. Soz.pol. 38, 1919;
Th. Mann, in: Neue Freie Presse v. 21.1.1922;
F. Gundolf, in: Jb. d. Freien Dt. Hochstifts, 1931, S. 9-94;
I. Münch, Die Tragik in Drama u. Persönlichkeit F. G.s, 1931;
J. Nadler, Goethe u. G., in: Corona 3, 1933;
ders., G.s Selbstbildnis, in: Jb. d. Grillparzer-Ges. NF 2, 1942;
ders., F. G., Vaduz 1948;
R. Alewyn, G. u. d. Restauration, in: Publications of the English Goethe-Society, New Series 12, Cambridge 1937, S. 1-19;
C. J. Burckhardt, G. u. d. Maß, in: ders., Gestalten u. Mächte, 1941, S. 223-53;
ders., in: Die Gr. Deutschen III, 1956, S. 245-57 (P);
B. v. Wiese, Gesch. d. dt. Tragödie, 1949;
F. Sengle, Das dt. Gesch.drama, 1952;
O. Rommel, Die Alt-Wiener Volkskomödie, Ihre Gesch. v. barocken Welt-Theater b. z. Tode Nestroys, 1952;
M. Kommerell, G., Ein Dichter d. Treue, in: ders., Dichter. Welterfahrung, Essays, 1952, S. 7-23;
G. Baumann, F. G., Stud. z. s. Werk u. z. österr. Wesen, 1954;
ders., Ein Bruderzwist in Habsburg, in: Das dt. Drama, hrsg. v. B. v. Wiese I, 1958, S. 422-50;
E. Hock, Libussa, ebd., S. 451-74;
W. Naumann, G., Das dichter. Werk, o. J. (1956);
ders., Kg. Ottokars Glück u. Ende, in: Das dt. Drama, hrsg. v. B. v. Wiese I, 1958, S. 403-11;
E. Staiger, G.s „Kg. Ottokars Glück u. Ende“, in: ders., Meisterwerke dt. Sprache aus d. 19. Jh., ³1957, S. 163-85;
J. Kaiser, G.s dramat. Stil, 1961;
M. Enzinger, F. G. u. Therese Utsch, 1963;
Joachim Müller, F. G., 1963 (Bibliogr.);
Goedeke VIII, S. 317-459, XI, 2, S. 129-71;
H. Seidler, F. G., Ein Forschungsber., in: Zs. f. dt. Philol. 83, 1964, S. 228-42;
Kosch, Lit.-Lex. -
Porträts
Zeichnung v. J. Schmeller, 1826 (Weimar, Goethe-Nat.mus.), Abb. in: C. Ruland, Aus d. Goethe-Nat.-Mus. I, 1895;
Aquarell v. M. M. Daffinger, 1827;
Ölgem. v. H. Hollpein, 1836;
Ölgem. v. F. Waldmüller (alle Wien, Städt. Slgg.);
Lith. v. J. Kriehuber, Abb. b. Werckmeister;
Gem. v. A. Hähnisch, 1849 (Frankfurt/M., Goethe-Mus.), Abb. b. Rave;
Gem. v. D. Penther, 1872 (Wien, Hist. Mus.), Abb. ebd.;
H. W. Singer, Allg. Bildniskat. V, 1931, 34 586-611. -
Autor/in
Gerhart Baumann -
Zitierweise
Baumann, Gerhart, "Grillparzer, Franz" in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 69-75 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118542192.html#ndbcontent
-
Grillparzer, Franz
-
Biographie
Grillparzer: Franz G., geb. am 15. Januar 1791 zu Wien als Sohn eines wohlhabenden Advocaten, der aber durch einen ungetreuen Beamten und die Wirrsale des Krieges sein Vermögen eingebüßt hatte und 1809 starb. Er studirte die Rechte und suchte, indem er Unterricht ertheilte, ja während längerer Zeit eine Hofmeisterstelle bei einer gräflichen Familie bekleidete, sich und die Seinen, unter denen er besonders seine Mutter zärtlich liebte, fortzubringen. 1813 trat er als Beamter bei der k. k. Hofkammer ein, von welcher Stelle er, zum kleineren Theil durch eigne Schuld, zum weitaus größeren durch Mißgunst und niedrige Gesinnung seiner Vorgesetzten nicht recht vorwärts kam (kurze Zeit hindurch bezog er auch als Dramatiker des Burgtheaters ein Gehalt), bis er 1833 Archivdirector im Finanzministerium (vgl. aber Werke, X, 237 f.) wurde. Er mußte diesen Posten, trotz mehrerer Versuche einen anderen zu erlangen, behalten und wurde 1856 mit dem Hofrathstitel pensionirt. Von da ab lebte er in sehr bescheidenen Verhältnissen unter der sorgsamen Obhut der Schwestern Fröhlich, an deren eine, Kathi, ihn Bande zarter, aber inniger Zuneigung knüpften. Aus Wien war er nur selten fortgekommen (1819 reiste er nach Italien; 1826 nach Deutschland, um Goethe zu sehen; 1836 nach Frankreich und England; 1843 nach Griechenland), während der Jahre seines Alters nahm er öfters kurze Aufenthalte in verschiedenen Bädern. G. war durch seine Zurückgezogenheit fast zu einer mythischen Person geworden; er und seine Dichtungen schienen einer längst vergangenen, durch das J. 1848 abgeschnittenen Periode anzugehören. Erst im Anfange der sechziger Jahre brachte die, mit den Aenderungen politischer Verhältnisse verknüpfte lebhaftere geistige Bewegung auch G. wieder an die Oberfläche des Tagesinteresses. H. Laube erwarb sich um ihn ein besonderes Verdienst, indem er G.'s Stücke, vortrefflich inscenirt, neu aufführte und seinen mächtigen Einfluß für sie geltend machte. Es steigerte sich die Theilnahme an der Person des Dichters und seinen Werken bald außerordentlich. Die|Fülle der Ehrenbezeugungen, welche sich — zu spät, um ihn herzlich zu erfreuen — über ihn ergoß, die Begeisterung aller gebildeten Kreise, gibt Zeugniß davon, daß das neuerwachte österreichische Bewußtsein in ihm seiner Verkörperung huldigte. Als er am 21. Januar 1872 starb und eine ungezählte Menge dem Sarge folgte — ein Leichenbegängniß, wie es vielleicht seit Klopstock keinem deutschen Dichter zu Theil geworden war — trauerte man nicht blos in Ehrfurcht um den Dichter, sondern auch um den Altösterreicher.
Von diesem Standpunkte aus müssen auch Grillparzer's Werke beurtheilt werden“ die Werke eines deutschen, vorzüglich aber österreichischen Dichters. Grillparzer's dichterische Thätigkeit concentrirt sich in seinen Dramen. Das Wenige, was er sonst noch geschrieben hat, zeigt zwar, daß sein Talent nicht einseitig war, aber er hat dazu wol kaum seine ganze Kraft aufgeboten. Manche dramatische Versuche, unter denen G. einen selbst erwähnt, „Blanca von Castilien“, sind der „Ahnfrau“ von 1816 vorausgegangen. Der Verkehr mit Schreyvogel, dem scharfsinnigen und kenntnißreichen Secretär des Hofburgtheaters, gab den Anlaß, eine Combination von ein paar Abenteuerstoffen in diesem Stücke dramatisch zu gestalten. Binnen 16 Tagen war es geschrieben; die Raschheit des Entstehens ist verbündet mit der Raschheit der Entwicklung in diesem Trauerspiel. Zeit seines Lebens hat G. sich dagegen gewehrt, daß die „Ahnfrau“ als Schicksalstragödie bezeichnet werde. In dem Sinne Müllner's und Zacharias Werner's ist sie es nun gewiß nicht. Allein schon der Titel an und für sich erweckte die Vorstellung, daß nicht Jaromir's Zügellosigkeit den Mord, Bertha's und Jaromir's Gluth die blutschänderische Liebe bewirke, sondern das Eingreifen einer gespenstischen Macht. Nicht die Stelle, welche G. nach Laube's Angaben (Werke II, 151 ff.) einfügte, um den Anmerkungen von Schreyvogel genug zu thun, sondern viele andere bestärken in dieser Auffassung. So die Verse, welche Borotin spricht, als ihm der verhängnißvolle Dolch gewiesen wird: „Ich seh' dich, und es wird helle, hell vor meinem trüben Blick? Seht ihr mich verwundert an? Das hat nicht mein Sohn gethan! Tiefverhüllte, finstre Mächte lenkten seine schwache Rechte". Wie dem aber auch sei, die energische Charakterzeichnung, der rasche Aufbau der Handlung, die Trochäen, deren wohlklingender Fluß die Gedanken mitzureißen scheint, verfehlen nicht, wie schon bei der ersten Aufführung (31. Januar 1817), gewaltigen Eindruck zu machen. — „Sappho" folgte schon im nächsten Jahre. Hier ist keine wild sich überstürzende Masse von Ereignissen zu bewältigen, ein knapper Stoff wird maßvoll ausgewerthet. Statt der markirenden Züge in der „Ahnfrau" liebevolle Vertiefung in die Charaktere, Eingeh'n in psychologische Details, sorgsame Wahl äußerer Zeichen für innere Bewegung. Dies kommt Sappho wie Melitta, einer der zartesten und liebenswürdigsten Gestalten neuerer Poesie in gleichem Maße zu gute. Man hat diesem Drama gegenüber, unterstützt von Scene, Kostüm, von der überaus geschickten Benutzung der Sapphischen Fragmente, das Gefühl, es habe in der Seele des Dichters das Stürmische, Wilde, sich abgeklärt. Mit „Sappho" beginnen die Dramen Grillparzer's, in denen Antike und Romantik geeint werden. Kein Zwiespalt, nichts fremdartiges wird dabei empfunden, beide Elemente haben sich durchdrungen. Das Stück ist so antik, als es ein modernes Stück nur sein kann, d. h. die Einfachheit des Alten ist durch ein romantisches Medium gegangen. — Von 1818—1820 entstand die Triologie „Das goldene Vließ". Die drei Abschnitte sind: „Der Gastfreund", „Die Argonauten“, „Medea“. Der Stoff mußte mit vieler Kunst eingerichtet und erweitert werden, um zur Trilogie zuzureichen. Eine Trilogie im antiken Sinne ist doch nicht daraus geworden; G. hat selbst (Werke X, 39 f.) trefflich darüber gesprochen. Dem Wiener Publicum, dessen Urtheil G. als maßgebend anerkannte, rangen die Dramen nur einen Achtungserfolg ab,|und die Schwäche Jason's ist freilich eine gefährliche Klippe, gefährlicher als das Rohe der Kolcher, als das schwer zu begreifende in den Motiven und dem Apparate der beiden ersten Theile. Aber es bleibt das Werk eine großartige Composition, und wie Medea dämonisch emporwächst, ohne dem menschlich erschütternden sich zu entfremden, ist einzig gelungen. Technische Schwierigkeiten und der Mangel eines Publicums, ernst genug, um diese harte Tragik zu würdigen, schieben diese Trilogie unverdient hinter andere Werke Grillparzer's zurück. — Besseren Erfolg genoß „König Ottokars Glück und Ende“ (1822). Es ist das erste historische Drama Grillparzer's. Durch ungemein sorgfältige Quellenstudien ist es vorbereitet worden. Während die früheren Dramen aufs engste in der Zahl der Personen sich beschränkten, wird hier die Bühne durch eine bunte Fülle belebt. So insbesondere der erste Act, dessen große Scenen man fast dem polnischen Reichstag in Schiller's Demetrius vergleichen könnte. Nothwendig mußte auch die Art der Charakteristik sich ändern. Rudolf und Ottokar setzen aus einer Menge nur kleiner Züge, wie sie die rasche Handlung gestattet, sich zusammen. Die dramatische Spannung konnte nicht erhalten werden. Nach der großen Scene zwischen Ottokar und Rudolf fällt sie ab. Auch hat Ottokar sich wenig Theilnahme gewonnen und des Zuschauers Gefühl über die Gerechtigkeit seines Schicksals kann nicht schwanken. Daß G. bei Ottokar an Napoleon dachte, ist bekannt; in der Handschrift lautete der Titel des Werkes: „Eines Gewaltigen Glück und Ende“. — „Ein treuer Diener seines Herrn“ (1826) ist, was die Composition anlangt, vielleicht die beste Arbeit Grillparzer's. Unübertrefflich macht die erste Scene nicht blos alle Verhältnisse klar, sondern prägt auch die Stimmung des Ganzen ein. Aber der Stoff widerstrebt unserer Empfindung und alle Kunst kann nicht darüber hinwegbringen, daß Bancbanus seine menschliche Pflicht, für uns die höchste, der des Königsdienstes opfert. Servilismus, wie G. vorgeworfen wurde, ist nicht der Geist dieses Drama's, allein das unglückliche Problem erweckt leicht den Schein davon. — Mit „Des Meeres und der Liebe Wellen“ (1831) greift G. zu den antiken Stoffen zurück, jetzt durch große Arbeiten geschult, im Vollbesitze seiner Kraft. Dieses Drama bezeichnet den Höhepunkt seines Schaffens. Der Balladenstoff von Hero und Leander gibt die Grundlage ab und wird nur durch wenige Gestalten erweitert, deren keine man Nebenfigur nennen kann, denn das Eingreifen jeder ist unentbehrlich, und geht aus den kurz aber scharf angedeuteten Eigenheiten ihres Charakters zwingend hervor. Selbst dort, wo, wie im 4. Act, die Handlung stille zu stehen scheint, wird die Stimmung fortwährend gesteigert, so daß die Mängel des Stoffes nicht empfunden werden. Auch Sprache und Vers lehren, daß dieses Drama Grillparzer's reifstes und vollendetstes Werk ist. — „Der Traum, ein Leben“, stellt sich durch die ganze Anlage und Zeichnung neben die „Ahnfrau“. 1828 schon war der Plan entworfen und der erste Act ("Des Lebens Schattenbild") fertig, erst am Ende der zwanziger Jahre (?) wurde das Stück fortgeführt und beendet, 1834 wurde es am Burgtheater gegeben. Den Stoff entnahm G. der Erzählung Voltaire's „le blanc et le noir“ (Voltaire, große Didot’sche Ausgabe VIII, 414—419). Die Charakteristik verbirgt sich ganz in der Handlung, die Hauptlinien sind mit starken Strichen entworfen, alles übrige muß die Darstellung bringen. Doch gerade diese Eigenschaften machten das Stück wirkungsvoll und sicherten den Erfolg. — 1838 am 6. Mai wurde Grillparzer's Lustspiel „Weh' dem, der lügt“, im Burgtheater aufgeführt, vom Publicum abgelehnt und in pöbelhafter Ungezogenheit ausgepfiffen. Nach einer Erzählung bei Gregor von Tours (III, 15) ist das Stück gearbeitet. G. hat es mit Unrecht als Lustspiel bezeichnet, denn Problem und Ausführung sind dazu ungeeignet. Nur eine bunte, vielgestaltige Intrigue hätte dies Thema etwa|zum Lustspiel brauchbar machen können. Hier aber ist die Handlung einfach, zu einfach; daß alle lügen, indem sie die Wahrheit sprechen, ist weder scharf noch witzig genug hervorgehoben; die Situationen sind nicht komisch; manche Aeußerlichkeiten stören. — Die erfahrene Mißhandlung hatte G. so verletzt, daß er fortan keine neue Arbeit mehr aufzuführen gestattete. Nur in den letzten Jahren wurde für ein paar Fragmente ihm die Erlaubniß abgerungen. Er arbeitete fort, nun wol langsamer, überlegender, die Phantasie bedächtig zügelnd. Zunächst wahrscheinlich beschäftigte ihn „Libussa“. Wieder ein Mährchen, aber von ruhiger, fast gemächlicher Entwickelung. Sinnreicher Kampf mit klugen Worten um Räthsel gibt den Mittelpunkt, die scheidende Märchenzeit zieht Libussa mit sich, und überläßt dem lebenskräftigen, aber rauhen und harten Menschenthum die Erde. Viel fester als in dem für Beethoven gearbeiteten (Werke VIII, 110 ff.) Operntext „Melusine" ist die Mährchenstimmung hier festgehalten. Die Reden sind breiter, sentenzenreicher als früher. — Unbedingt neben „Hero“ steht das Fragment „Esther“. Daß es ein Fragment ist, fühlt wol jeder: die Fäden, welche zu einer Verschwörung für Vasthi sich knüpfen sollen, sind plötzlich abgerissen. Allein die Scene zwischen Hadassa und dem König klingt so schön aus, daß sich Wünsche nach mehr unterdrücken lassen. Wie G. das Werk fortgesetzt hätte, ist aus seinen eigenen Angaben (Littrow S. 157 ff.), die von den trüben Reflexionen des Alters beeinflußt sind, nicht zu erschließen. — Eine große historische Aufgabe sucht G. zu lösen im „Bruderzwist im Hause Habsburg“. Aber das ist kein Drama mehr. Es ist eine großartige dramatische Studie. Den Charakter Kaiser Rudolfs II. erschöpfend zu schildern, wie er umgeben ist von den Typen des habsburgischen Hauses, werden eine Anzahl von Scenen aufgerollt. Die Studie ist nun freilich meisterhaft, und es baut die dichterische Intuition hier aus dem spröden historischen Material eine lebendige Gestalt, bis in die feinsten Züge klar und verständlich auf. Delavigne's Louis XI. erscheint daneben roh und holzschnittartig. Daß über Rudolf alles Licht sich vereinigt, daß die übrigen Figuren nur die Schattenabstufungen liefern, damit die Helle um ihn stärker hervortrete, schädigt den Kern des Dramas und seine Bühnenwirkung. — Den Dankeszoll, welchen G. Lope de Vega schuldet, hat er noch äußerlich abgetragen durch die „Jüdin von Toledo“ (Chmelarz, Oesterr. Wochenschrift 1872, 2. S. 481 ff., 551 ff.). Zu Grunde liegt ein Stück des spanischen Dichters. Aber Grillparzer's Drama theilt mit diesem nur die Aeußerlichkeiten der Handlung; die Motive, welche dort aus den rohen Zuständen und dem Barbarismus spanischer Loyalität aufsteigen, sind hier aus den feingezeichneten Charakteren entquollen. Doch fehlt es der Handlung an Energie, die Liebe des Königs zu Rahel hat allzuviel vom bloßen Abenteuer, als daß der Tod der Jüdin gerechtfertigt wäre. Dieser bleibt ungerecht, grausam. Daher erklärt sich auch der geringe Erfolg des sonst sorgsam gearbeiteten Stückes. — Die Scene „Hannibal und Scipio vor Zama“ nenne ich nur als treffliche, rhetorische Studie. —
G. hat zwei prosaische Novellen verfaßt. Schon die erste „Das Kloster von Sendomir“ (1828) erhebt sich durch die einfache, aber hier doppelt wirksame Erzählung des Gräuels über das Gewöhnliche und erinnert an Halms Novellen. Die zweite „Der arme Spielmann“ (1848) ist ein Meisterwerk: der Träumer, jeglicher Initiative entbehrend, fristet das ärmliche Leben nur durch seine groteske Begeisterung für Musik. Die Localfarben, die alle Effecte absichtlich meidende Einfachheit des Stiles, erhöhen das Ergreifende.
Von G. sind auch Reisetagebücher und ein Stück Selbstbiographie hinterlassen worden. Er glaubte als Mitglied der Wiener kaiserlichen Akademie der Wissenschaften sich zu einer autobiographischen Skizze verpflichtet, hat sie|aber nicht sehr weit geführt. Nur die erste Zeit ist eingehend behandelt; immer kürzer faßt sich die Darstellung; wie „Des Meeres und der Liebe Wellen“ entstanden ist, wird zuletzt erwähnt. Wenn nun diese Selbstschilderung auch sehr viel Werthvolles für die nähere Erkenntniß von Grillparzer's Wesen enthält, so darf sie doch in Bezug auf thatsächliche Angaben nur mit Vorsicht benutzt werden. Denn nirgends hat die Chronologie der Ereignisse im Gedächtniß Stand gehalten, nicht minder sind die persönlichen Beziehungen verwirrt und durcheinandergeschoben. Vielleicht nicht ganz absichtslos, denn das Vorbild von „Wahrheit und Dichtung“ ist unverkennbar. — Drückende, widerliche Verhältnisse des väterlichen Hauses legten schon im Jüngling den Grund zu einem Mißmuth, von dem sich der Mann nie ganz hat befreien können. Immer mehr fand er sich in Widersprüchen hin- und hergezerrt. Er haßte und verachtete den Beamtendienst und doch strebte er nach Anerkennung und war schmerzlich gekränkt, als sie ihm versagt wurde. Er gehörte während der Zeit des drückenden Despotismus zu den vorgeschrittenen Liberalen, erst die Revolution machte ihn scheu, damit vereinte er treue, durch nichts erschütterte Anhänglichkeit an die Dynastie und festen Glauben an die Mission Gesammtösterreichs. Er kannte genau die ganze Luft von Gemeinheit und Dummheit, von Rohheit und Lüge, in der er leben mußte und das Behagen der Niedrigen mit ansehen, doch liebte er innig die Heimath, die engsten Stadtgenossen. — Seine Productionskraft ließ sich durch all dies nicht zurückhalten; erst spät, im Alter, verkümmerte sie allmählich. Es war eben seine Begabung außerordentlich. Sie wurde gefördert durch die günstigsten Umstände. Für Wien bildete vom Ende des 18. Jahrhunderts an bis 1848 das Theater den Mittelpunkt geistigen Lebens; vielen war es die einzige Stelle, an der sie von schöner Litteratur erfuhren. Ein neues Stück war wochenlang Gegenstand des Gesprächs, sowol theoretischer Erwägungen als Klatschens über Details der Aufführung. Die zahlreichen belletristischen Zeitschriften Wiens, besonders von 1808 an, gaben Theaterreferate in der Hauptrubrik. Die Lust des Publicums wurde durch die Trefflichkeit der Schauspieler, sowie geraume Zeit durch die ausgezeichnete Leitung des Burgtheaters (Schreyvogel-West, der treue Freund und kritische Berather Grillparzer's war Secretär der Intendantur) erhöht. Kleine theatralische Aufführungen in Familienkreisen waren häufig, auch G. hat als Knabe solche mitgemacht. Der Jüngling G. erarbeitete sich in hartem und mühevollem Studium die genaue Kenntniß der dramatischen Litteratur der Spanier. Diese bezeugen seine „Studien zum spanischen Theater“ (Werke VIII, 121—344). Sie bieten nach einigen Vorbemerkungen über das Leben Lope de Vegas, kritische Analysen seiner Stücke, die vor den sehr guten v. Schack's den Vorzug haben, daß immer die bühnenwirksamsten Stellen besonders hervorgehoben und besprochen werden. Gewiß hat G. hier sehr viel gelernt (Ottokar, Esther) und vor allem die Kunst der Exposition. — Von sich selbst sagt G. (Werke X, 94): „In mir leben zwei völlig absonderte Wesen. Ein Dichter von übergreifender, ja sich überstürzender Phantasie, und ein Verstandesmensch der kältesten und zähesten Art.“ So schädlich das Nebeneinander dieser Elemente seinen lyrischen Dichtungen gewesen, in denen es ihm nur selten gelang, beide in harmonischer Wirkung zu versöhnen, wo übermäßige Bilderpracht und trockene, fast dem Amtsstil entlehnte Phrasen beisammen stehen, so vortheilhaft erwies es sich dem Dramatiker. G. hat nur für die Bühne gedichtet; er will ausdrücklich nicht, daß seine Dramen gelesen werden. So zu sagen im Angesicht der Bühne hat er auch geschrieben; ihm verkörperte sich jede Scene sogleich und zwar nicht zu einem Bilde überhaupt, sondern zu einem Bühnenbilde ϰατ̓ ἐξοχην. Ungemein bezeichnend ist, was er über sein Stück „Der Traum, ein Leben“ schreibt: „Als ich mit meinem|Mondkalbe fertig war, übergab ich es meinem Freunde Schreyvogel zur Aufführung. Dieser war gar nicht gut darauf zu sprechen. Er zweifelte an der Möglichkeit einer Wirkung auf dem Theater, die bei mir völlig ausgemacht war; hatte ich es doch aufführen gesehen, als ich es schrieb“ (Werke X, 193). Der Einfluß von Schiller und Müllner auf Grillparzer's erste Dramen ist nachweisbar, der Goethe's hat ihn sein Leben lang beherrscht, ohne seiner Eigenart Abbruch zu thun. Diese, welche ihm seine besondere Stellung in der deutschen Litteratur erworben hat, besteht — zwar theilt er auch seine technische Gewandtheit nur mit wenigen — in der warmen, nie unedlen Sinnlichkeit, von der alle seine Gestalten durchflossen sind. Der Idealismus seiner Jugendarbeiten, die Rhetorik und die zögernde Reflexion seines Alters, sie vermögen diese Wärme nicht zu mindern, welche seinen Schöpfungen die Realität des Naiven verleiht. Seine Eigenart ist auch die seines Stammes (dessen Redeweise mit ihren Mängeln sich in seiner Sprache wiederfindet), veredelt durch einen reinen Sinn, dem die Kunst Lebensprincip war, der sie nie in den Dienst des wandelbaren Tagesgeschmackes stellte, sondern in unbeirrter Begeisterung sich ihr ganz hingab.
-
Literatur
F. Grillparzer's Sämmtliche Werke, herausgegeben von H. Laube und J. Weilen, 10 Bände, Stuttgart, Cotta, 1872. Die Ausgabe ist nicht gut. Weitaus das Beste, was über G. geschrieben worden, ist die Abhandlung von Wilh. Scherer, Vorträge und Aufsätze, Berlin 1874, S. 193—307. Sonst sind noch zu nennen: Hieronymus Lorm, Wiens poetische Schwingen und Federn, Leipzig 1847, S. 91—120. C. v. Wurzbach, Festschrift. Wien 1871. Emil Kuh, Zwei Dichter Oesterreichs, Pest 1872. Karl Tomaschek, Nekrolog im Almanach der kaiserl. Akademie der Wissenschaften für 1872. S. 211—225. Auguste v. Littrow, Aus dem persönlichen Verkehr mit F. G., Wien, Rosner 1873.
-
Autor/in
Anton , Schönbach. -
Zitierweise
Schönbach, Anton, "Grillparzer, Franz" in: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879), S. 671-676 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118542192.html#adbcontent